Moose und Flechten zählen zu den Hidden Champions des Waldes oder anders ausgedrückt: sie sind Pflanzen, die im übertragenen Sinn so sehr im Verborgenen gedeihen, dass man sie auch als „Kryptogamen“ – Geheim-Blüher – bezeichnet. Grund genug, mal ein paar Geheimnisse zu lüften.
Da sind die grünen Moosteppiche, die gleich einen tristen Nadelwald in einen zauberhaften nordischen Märchenwald verwandeln, wo man Elfen und Trolle hinter den Felsen zu sehen meint – jedenfalls auf den ersten Blick. Auf den zweiten – den Lupenblick – erkennt man: Moose sehen aus wie kleine Bäume. Sie bestehen aus Stämmchen und Blättchen. Stämmchen und Blättchen, diese verniedlichenden Bezeichnungen sind tatsächlich der korrekte Ausdruck für die filigranen Teile der Moospflanze. Das erzählt Biologe Dr. Karl-Heinz Linne von Berg, mit dem wir die spezielle Welt der Kryptogamen entlang des Eifelflusses Rur bei Monschau erkunden. Fotograf Daniel Elke ist dabei, der das federige Grün aus seinem Blickwinkel einfangen wird.
Nimmermüder Moosforscher
Dr. Karl-Heinz Linne von Berg hat über 40 Jahre an der Kölner Uni gelehrt, jetzt ist er im Ruhestand oder besser gesagt im „Unruhe-Stand“, betrachtet man seine To-do Liste. Er ist Projektleiter für die Sparte Schlauchalgen bei der sogenannten „Rote Liste“, er organisiert Kurse im Naturschutz-Bildungshaus Eifel-Ardennen-Region und er fährt mit Studenten nach Norwegen, genauer gesagt nach Spitzbergen, um zu forschen.
Wir treffen uns am Parkplatz Dreistegen. Als Linne von Berg zunächst die Heckklappe seines Kofferraums öffnet, überrascht uns seine kleine Kofferraum-Ausstellung. Einige Moospolster sind gefällig in einem Gefäß platziert, daneben Fachbücher und eine Holzschatulle, die einen Teil seines Herbariums beinhaltet. Wir sind für einen Moment überwältigt von diesem Einstieg zur Moosexkursion. Es sind thallose Lebermoose, die in der Wanne liegen. Die hat er mitgebracht, weil sie etwas Besonderes sind und hier nicht überall wachsen. „Bei den thallosen Lebermoosen werden keine Blättchen und Stämmchen gebildet, sondern sie bestehen aus einem einheitlichen, gelappten Thallus“, erklärt er.
Moose - unersetzlich und tolerant
Nun aber in den Eifeler Wald. Es nieselt an dem Tag unserer Exkursion. Sachte fallen Wassertropfen auf Bäume und Sträucher. In vielen Grüntönen leuchten die Mooskolonien. „Besonders im Nadelwald verbreiten sich Moose gerne “, sagt Linne von Berg. Sie lieben das feucht-saure Bodenmilieu. Eines davon ist das schöne Frauenhaarmoos. Nicht dass das Moos mit der kräftigen Struktur und den vielen Blättchen besonders schön wäre, jede Moosart hat ihre hübschen Facetten und auch das Adjektiv habe nicht ich gewählt. Schönes Frauenhaarmoos heißt einfach so.
Auch das nächste Moos, das uns Linne von Berg zeigt, trägt einen besonderen Namen. Es ist das aloeblättriges Filzmützenmoos, dessen rosettenartige Blättchen-Anordnung an eine Aloe erinnert. Er zeigt uns die Sporenkapseln, die wie Stifte mit einer Haube aus dem Grün herausragen und spricht die komplexe Fortpflanzung der Moose an. „Sie können sich sowohl vegetativ als auch sexuell fortpflanzen“, erwähnt unser Guide. Als Nicht-Biologen reicht uns die Information, dass sich das Thujamoos sexuell fortpflanzt und Sporen bildet. Öffnen sich die Sporenkapseln, strömen hunderttausende Sporen heraus, die durch den Wind fortgetragen werden. Viele Kilometer weit. So könnten sich, sollte es in unserem Breitengrad viel wärmer werden, Moosarten aus dem mediterranen Raum hier ansiedeln. Auf die grünen Moosteppiche müssten wir dann nicht verzichten.

Biologische Nischen ohne Ansprüche
„Moose bewohnen Orte, die für Bäume ungeeignet sind“, bringt es Linne von Berg auf den Punkt. Sie sind bei ihrer Standortwahl nicht wählerisch, Deshalb haben sie auch den harten, über Jahrmillionen andauernden Konkurrenzkampf gegenüber der „höheren Pflanzenwelt“ für sich entschieden. Es ist wie das Versteckspiel bei Kindern. Die Kleinen können in jeden Winkel schlüpfen. Den Großen bleiben diese verwehrt. Nicht viel anders ist es bei den Moosen.
Feuchte Schatten und wenig bis gar keine Erde, in der sie tiefere Wurzeln schlagen könnten – das ist ihre Welt. Hat der Wind nur ein wenig Staub in einer Felsenritze zusammengetragen, so erobern sie sich die felsige Fläche. Moose haben eine wichtige Pionierfunktion bei der Besiedlung von Lebensräumen, betont Linne von Berg. Und weil sie so erfolgreich sind, kommen sie weltweit fast überall vor. Insgesamt wachsen um die 20 000 verschiedene Arten auf unserer Erde.
Kein Wasser - kein Problem
Die unscheinbaren grüne Pölsterchen sind Generalisten. Linne von Berg nimmt ein Stück Moos und drückt es aus. „Bei Regen saugen sich Moose über ihre Stiele und kleinen Blättchen mit Wasser buchstäblich voll wie ein Schwamm“, erklärt er. Im Gegensatz zu Blütenpflanzen haben sie weder Wurzeln noch Leitgefäße, um Wasser aufzunehmen. Sie absorbieren Wasser sowie auch Nährstoffe über die gesamte Oberfläche. Mehr noch, mit ihren sogenannten Rhizoiden, also Zellfäden, verankern sie sich im Boden. Somit verhindern sie nicht nur, dass der Boden vom Regen ausgewaschen wird und erodiert, sondern speichern auch große Wassermengen – es kann ein Vielfaches ihres Eigengewichts sein – die sie nach und nach wieder abgeben. So tragen sie zu einem gesunden Waldklima bei.
Dies bedeutet auch: kein Wasser ist kein Problem. „Moose sind poikilohydrisch“ sagt Linne von Berg und erzeugt bei uns erst einmal große Augen. Was bedeutet der Begriff? Er bedeutet, dass Moose zu den wechselfeuchten Pflanzen zählen, dass sie bei Feuchtigkeit wachsen und bei Trockenheit in eine gewisse Starre verfallen und auf den nächsten Regen warten. Apropos Regen: wenn mit aller Wucht besonders dicke Wassertropfen auf den Boden klatschen, dann huschen kleine Waldbewohner wie Ameisen und Spinnen in die Hohlräume der Moose und freuen sich über den Schutz im Moos.

Moose mögen keine Sonne
Unser Weg ist insgesamt kurz. Auf der Weghälfte, nach ca. zwei Kilometern wechseln wir über eine Brücke auf die andere Flussseite. Es ist Mittag und ein paar Sonnenstrahlen schaffen ihren Weg durch die dichte Wolkendecke. Auf der Südseite ist die Moosvegetation deutlich spärlicher. „Nordhänge sind grundsätzlich moosreicher“, ergänzt Linne von Berg erklärend. Um die neun Moosarten hat er uns bisher gezeigt. Am Ende der Tour werden es vierzehn sein. Wir geraten in einen wahren Chlorophyll- und Namensrausch.
Linne von Berg hat seine Lupe dabei. Fassbar deutlich sehen wir die gefiederten Ästchen und spiralig angeordneten Blättchen des Etagenmooses. Die Anordnung der Blätter und ihre Gestalt bestimmen oft die Namen, die allesamt anschaulich, ein bisschen magisch, ein bisschen romantisch klingen. Kriechendes Schuppenzweig Lebermoos, Gemeines Gabelzahnmoos, Schöner Runzelpeter, Großes Muschelmoos und Koboldmoos – um ein paar Beispiele zu nennen. Um uns diesen Namen zu nennen, hat unser Experte aus seiner braunen Umhängetasche eine Mappe gezogen, die er extra zum Nachblättern eingesteckt hat. Als Wissenschaftler kennt er die lateinischen Bezeichnungen. „Die sind allgemeingültig, die deutschen Namen sind dagegen umgangssprachlich geprägt“.
Keine Konkurrenz im Lebensraum
Obwohl Moose und Flechten Konkurrenten sind, kommen sie gut miteinander aus. Hier gilt das Motto „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. „Flechten lieben Bäume mit saurer Rinde wie den Bergahorn“, ergänzt Linne von Berg. „Flechten muss man auch nicht von der Baumrinde kratzen, sie schaden den Bäumen nicht“. Wie Schorf umhüllen sie die langen Äste und bedecken kahle Felsen. Und wieder passt das Bild vom nordischen Märchenwald dazu. Flechten, die oft nur wenige Millimeter pro Jahr wachsen, gehören ebenfalls zu den langlebigsten Erdbewohnern.
Besonders auffällig hier sind die leuchtende Schwefelflechte und die Pflaumenflechte, umgangssprachlich auch öfter als „Eichenmoos“ bezeichnet. Flechten haben eine eigene Lebensform, eine Gemeinschaft aus Pilz und Alge bzw. Pilz und Cyanobakterium. „Während der Pilz die Flechte stützt und festigt und ihr einen Körper gibt, versorgen Alge bzw. Cyanobakterium durch Photosynthese den Pilz mit organischen Stoffen“, sagt Biologe Linne von Berg. „Man nennt die Cyanobakterien auch Blaualgen“. Diese besondere Lebensgemeinschaft wird auch als Hungersymbiose bezeichnet, da sich keiner von beiden allein ernähren kann.

Moose und der Klimawandel
Und was sagen uns diese Gewächse über das Klima? Hier an der Rur stellt Linne von Berg noch keinen bemerkenswerten Einfluss des Klimawandels fest. Flechten und Moose sind sensible Pflanzen, die sich gut an Klimaveränderungen anpassen. Schließlich gehören sie zu den ältesten Landpflanzen unseres Planeten. Der Hoffnung, dass die Natur hier weiterhin intakt bleibt, will er aber auch nicht zustimmen. Viele Moose- und Flechten sind stark gefährdet. Mehr Mut zur Wildnis und weniger menschliche Eingriffe schaffen eine Umgebung, in der Flechten und Moose gedeihen können, gibt uns Linne von Berg dann noch mit auf den Weg.

erleben
Wandern: Wald-Erlebnis in der Rureifel
Im romantischen Rurtal (Rundwanderweg 55), Länge 7,9 km: Urwüchsiger Hangwald und bunte Wiesen wechseln sich ab. Im Sommer blühen Pflanzenarten wie Margerite, Hahnenfuß oder Roter Fingerhut. Kloster Reichenstein, Mühle und Norbertuskapelle zeugen von einer langen Geschichte. www.monschau.de
Auf dem Eifelsteig: Der Eifelsteig ist insgesamt 313 km lang und in 15 Tagesetappen eingeteilt. Die Etappen 2 und 3 führen durch das Monschauer Land. Der Gipfel des 659 Meter hohen Steling bietet einen einzigartigen Panoramablick (Etappe 2). www.eifelsteig.de
Paradies im Perlenbachtal, Länge 3,6 km: Start: Parkplatz Gut Heistert. Der Weg (Nr. 23) ist kurz und beschaulich. Früher gab es im Perlenbachtal große Mengen von Flussperlmuscheln. Heute blühen im Frühjahr geschätzte 10 Millionen Narzissen auf den Wiesen am Fluss. www.monschau.de
wissen
Moos ist nicht gleich Moos
Über tausend verschiedene Moosarten gibt es in Deutschland. Man unterscheidet drei Gruppen: Laub-, Leber- und Hornmoose. Laubmoose erkennt man an ihren kleinen Blättchen, Hornmoose haben Stengel und sind länglich. Sie erinnern an ein Horn. Die Lebermoose wiederum verdanken ihren Namen ihrer leberartigen Form. Einen ganz speziellen Platz im Ökosystem nehmen Moose als Erbauer der Hochmoore ein. Ohne Torfmoose gäbe es diesen Lebensraum gar nicht.
Gut zu wissen
Wer bei Erkältungskrankheiten die Isla-Moos Lutschpastillen einnimmt, ahnt nicht, dass er sich in Wirklichkeit Flechten auf der Zunge zergehen lässt. Der Name „Isländisch Moos“ ist irreführend, denn unter dem Namen verbirgt sich die Strauchflechte Cetraria Islandica, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe arzneilich genutzt wird. Wegen des hohen Schleim- und Bitterstoffgehaltes wirkt das Isländisch Moos entzündungshemmend und reizlindernd bei Husten und Bronchitis.
Flechten - viele Formen, viele Farben
Weltweit gibt es 25.000 verschiedene Flechtenarten. In Deutschland sind es 2.380 Arten, davon sind etwa die Hälfte gefährdet. Flechten brauchen intakte, lichte Wälder mit dicken alten Bäumen. Man unterscheidet zwischen Krusten-, Blatt- und Strauchflechten. Krustenflechten sind dicht mit dem Untergrund verwachsen. Blattflechten liegen meist locker auf dem Untergrund auf. Strauchflechten ähneln kleinen Korallen und sind nur an einer Stelle mit dem Untergrund verwachsen. Flechten haben viele Farben. Sie leuchten von blau über gelb bis rot.
Ohne Moos nix los
Einen besonderen Platz nehmen die Moose als Erbauer der Hochmoore ein. Die Erbauer dieser einmaligen Biotope sind die Torfmoose. Diese speziellen Moospflanzen wachsen ständig weiter, ohne dass die älteren Moosteile im feuchten, aber sauerstoffarmen Bodenmilieu zersetzt werden. So entsteht eine kontinuierliche wachsende Torfschicht, die große Mengen CO2 bindet und dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt.


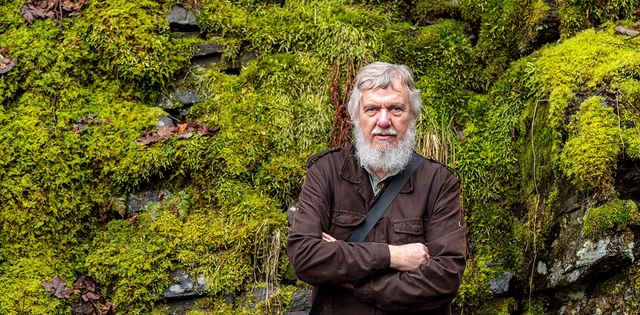





.png?width=75&height=75&fit=crop&format=webply)
